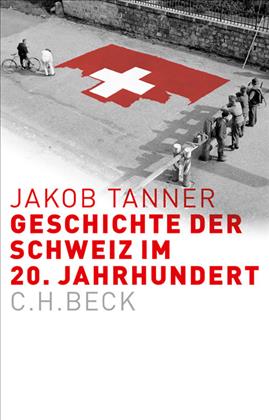Forschung
Laufende Einzelstudien
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderne Zeit. Neue Forschungen zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte des 19. und 20. JahrhundertsDie Reihe "Moderne Zeit. Neue Forschungen zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts" wird von Band 33 an herausgegeben von Jan Eckel, Ulrich Herbert, Lutz Raphael und Sven Reichardt im Wallstein Verlag, Göttingen. Folgende Bände sind bislang erschienen:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Band 2 | Das Reichsministerium der Finanzen in der Zeit des NationalsozialismusHomepage des Projekts: Das Reichsministerium der Finanzen spielte im „Dritten Reich“ beileibe keine Nebenrolle. Weder war es eine „Aufsichtsbehörde ohne politischen Rückhalt“, noch fungierte Lutz Graf Schwerin von Krosigk, der dem Haus von 1932 bis 1945 vorstand, lediglich als „Hauptbuchhalter der Nation“. Eine solche Interpretation liegt auf der Linie der Entlastungsstrategie leitender Beamter des Reichsfinanzministeriums nach 1945. Zwar konnten diese nicht einfach verschweigen, wie sie im NS-System agiert hatten. Doch entwarf die ehemalige Führungsspitze des Reichsfinanzministeriums mit hoher Deutungskraft das Bild einer politisch neutralen Verwaltung, die allein fachlichen Grundsätzen gefolgt sei. Hinter diesem Selbstbild verblasste, welchen unverzichtbaren Beitrag das Reichsfinanzministerium zum Funktionieren, zur Stabilität und damit zur verbrecherischen Politik des NS-Regimes geleistet hatte: erstens, indem es das Unrechtsregime samt seiner Politik der Aufrüstung und Kriegführung finanzierte; und zweitens, indem es sich dazu mit Steuern und Kredit nicht allein der herkömmlichen Mittel bediente, sondern in großem Umfang auf schlichten Raub setzte. Die historische Forschung hat sich in den letzten zehn Jahren in regional oder lokal angelegten Studien durchaus mit der Frage beschäftigt, ob und wie die Finanzbürokratie an der Verfolgungs- und Raubpolitik des NS-Regimes mitwirkte. Was bis heute fehlt, ist eine wissenschaftliche Untersuchung von Struktur, Tätigkeit und politischem Gewicht des Ministeriums in der Zeit des Nationalsozialismus. 2009 beauftragte das Bundesministerium der Finanzen deshalb eine siebenköpfige, international zusammengesetzte Kommission von unabhängigen Historikern, genau das zu untersuchen. Das Forschungsprogramm, das die Kommission entworfen hat, bündelt sich zu drei Schwerpunkten: Der erste Schwerpunkt ist eine modernen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Geschichte des Reichsfinanzministeriums als Behörde (Projekt 1: Institutionengeschichte des Reichsministeriums der Finanzen). Die Behördengeschichte wird erweitert und vertieft durch Projekte, die sich den Säulen nationalsozialistischer Aufrüstungs- und Kriegsfinanzierung widmen. So nimmt der zweite Schwerpunkt die Steuerpolitik des Ministeriums in den Blick (Projekt 2: Steuerpolitik). Der dritte Schwerpunkt ist der nationalsozialistischen Raub- und Beutefinanzierung gewidmet: zum einen der fiskalischen Judenverfolgung (Projekt 3: Fiskalische Judenverfolgung); zum anderen der Einziehung des Vermögens der sogenannten „Reichsfeinde“ von den politischen Emigranten und den durch das Regime Ausgebürgerten über Sinti und Roma bis hin zu politisch missliebigen Personen und Institutionen (Projekt 4: Vermögen der „Reichsfeinde“); schließlich der Ausplünderung der eroberten Länder (Projekte 5: Reichsfinanzverwaltung im Generalgouvernement; Projekt 6: Reichsfinanzministerium und monetäre Ausbeutung Europas). Bei den skizzierten Schwerpunkten wird es jeweils darum gehen, die Handlungsspielräume bei der Mixtur aus Steuer-, Kredit- und Raubfinanzierung auszuloten. Damit verbindet sich die Frage, welche Stellung das Finanzministerium im nationalsozialistischen Herrschaftsgefüge innehatte, wo seine Macht wuchs, wo es an Einfluss verlor, welche Netzwerke es innerhalb des Ministeriums gab, wie Entscheidungsprozesse abliefen. Wissenschaftliche Kommission:
Erschienene Bände:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
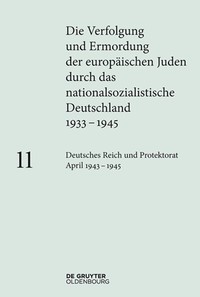 Band 11 | Quellenedition: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden 1933-1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band 1: | Deutsches Reich 1933 - 1937, bearb. v. Wolf Gruner, München 2008. |
| Band 2: | Deutsches Reich 1938 - August 1939, bearb. v. Susanne Heim, München 2009. |
| Band 3: | Deutsches Reich und Protektorat September 1939 - September 1941, bearb. v. Andrea Löw, München 2012. |
| Band 4: | Polen Sept. 1939 - Juli 1941, bearb. v. Klaus-Peter Friedrich, München 2011. |
| Band 5: | West- und Nordeuropa 1940 - Juni 1942, bearb. v. Katja Happe, Michael Mayer, und Maja Peers, München 2013. |
| Band 6: | Deutsches Reich und Protektorat Böhmen und Mähren Oktober 1941 - März 1943, bearb. v. Susanne Heim, Berlin 2019. |
| Band 7: | Sowjetunion mit annektierten Gebieten I: Besetzte sowjetische Gebiete unter deutscher Militärverwaltung, Baltikum und Transnistrien, bearb. v. Bert Hoppe und Hildrun Glass, München 2011. |
| Band 8: | Sowjetunion mit annektierten Gebieten II: Generalkommissariat Weißruthenien und Reichskomissariat Ukraine, bearb. v. Bert Hoppe, München 2015. |
| Band 9: | Polen: Generalgouvernement August 1941 - 1945 bearb. v. Klaus-Peter Friedrich, München 2014. |
| Band 10: | Polen: Die eingegliederten Ostgebiete August 1941 - 1945, bearb. v. Ingo Loose, Berlin 2020 |
| Band 11: | Deutsches Reich und Protektorat Böhmen und Mähren April 1943-1945, bearb. v. Lisa Hauff, Berlin 2020. |
| Band 12: | Westeuropa: Juni 1942 - 1945, bearb. v. Katja Happe, Barbara Lambauer und Clemens Maier-Wolthausen, München 2014. |
| Band 13 | Slowakei, Rumänien, Bulgarien, bearb. v. Barbara Hutzelmann, Mariana Hausleitner und Souzana Hazan, München 2018. |
| Band 14 | Besetztes Südosteuropa und Italien, bearb. v. Sara Berger, Sanela Schmid, Erwin Lewin und Maria Vassilikou, München 2017. |
| Band 15: | Ungarn 1944 – 1945, bearb. v. Regina Fritz, München 2021. |
| Band 16: | Auschwitz 1942–1945 und die Zeit der Todesmärsche, bearb. v. Andrea Rudorff, Berlin 2018. |
Englische Ausgabe PMJ:
The Persecution and Murder of the European Jews by Nazi Germany, 1933–1945 (PMJ)
Link zur englischen Ausgabe PMJ.
Bisher erschienen:
| Volume 1: | German Reich, 1933–1937. |
| Volume 2: | German Reich 1938–August 1939. |
| Volume 3: | German Reich and Protectorate September 1939–September 1941. |
| Volume 4: | Poland September 1939–July 1941. |
| Volume 5: | Western and Northern Europe 1940–June 1942. |
| Volume 9: | Poland: General Government August 1941–1945. |
| Volume 12: | Western and Northern Europe June 1942–1945. |
Band 10
Europa im 20. Jahrhundert
Buchreihe, Verlag C.H. Beck, München
herausgegeben von Ulrich Herbert
Die geplante Buchreihe umfasst zunächst 11 Bände zur Geschichte europäischer Staaten im 20. Jahrhundert. Die Bände gehen von gemeinsamen Fragestellungen aus und sind nach einem einheitlichen zeitlichen Schema gegliedert. Besondere Aufmekrsamkeit gilt dabei der Zeitphase zwischen etwa 1890 und dem Ersten Weltkrieg mit der explosionsartigen Entfaltung der Industriegesellschaften und den 1970er Jahren an deren Ende: In diesen etwa 80 Jahren wurde das gesamte Arsenal an Optionen und Lösungsvorschlägen zu den Herausforderungen des Industrialismus entworfen und erprobt. Auf diese Weise soll es möglich werden, die Verflechtung zwischen den Weltkriegen, dem Holocaust, dem GuLag, dem Kolonialismus und dem Kalten Krieg sowie dem globalen Wiederaufstieg des demokratischen Kapitalismus nach 1945 zu untersuchen. Zugleich soll durch einen solchen Ansatz eine Basis für den Vergleich der europäischen Nationalgeschichten geschaffen werden, ohne den eine „europäische Geschichte“ des 20. Jahrhunderts nicht möglich ist.
Einzelbände:
- Hans Woller: Italien (2010)
- Franz-Josef Brüggemeier: Großbritannien (2010)
- Walter L. Bernecker: Spanien (2010)
- Wlodzimierz Borodziej: Polen (2010)
- Marie-Janine Calic: Jugoslawien (2010)
- Ulrich Herbert: Deutschland (2014)
- Jakob Tanner: Schweiz (2015)
- Dietmar Neutatz: Russland (2013)
- Matthias Waechter: Frankreich (erscheint vorr. Herbst 2018)
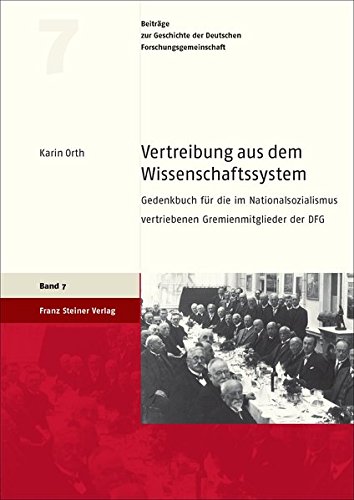
Band 7
Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1920-1970
Das Forschungsprojekt "Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1920-1970", wurde von Prof. Herbert und Prof. vom Bruch (HU Berlin) von 2001 bis 2008 geleitet und von der DFG gefördert. Es bestand aus 19 Einzelvorhaben, die an acht Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen durchgeführt wurden.
Die Ergebnisse wurden in zwei Buchreihen veröffentlicht, den „Beiträgen zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft“ und den „Studien zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft“, herausgegeben von Ulrich Herbert, Rüdiger vom Bruch und Patrick Wagner.
Bisher sind erschienen:- Corinna R. Unger: Ostforschung in Westdeutschland. Die Erforschung des europäischen Ostens und die Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1945 – 1975. Band 1, Stuttgart 2007.
- Anne Cottebrune: Der planbare Mensch. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die menschliche Vererbungswissenschaft, 1920–1970, Band 2, Stuttgart 2008.
- Sören Flachowsky: Von der Notgemeinschaft zum Reichsforschungsrat. Wissenschaftspolitik im Kontext von Autarkie, Aufrüstung und Krieg. Band 3, Stuttgart 2008.
- Willi Oberkrome: Ordnung und Autarkie. Die Geschichte der deutschen Landbauforschung, Agrarökonomie und ländlichen Sozialwissenschaft im Spiegel von Forschungsdienst und DFG (1920–1970). Band 4, Stuttgart 2008.
- Friedemann Schmoll: Die Vermessung der Kultur. Der "Atlas der deutschen Volkskunde" und die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1928-1980. Band 5, Stuttgart 2009.
- Klaas-Hinrich Ehlers: Der Wille zur Relevanz. Die Sprachforschung und ihre Förderung durch die DFG 1920–1970. Band 6, Stuttgart 2010.
- Gabriele Moser: Deutsche Forschungsgemeinschaft und Krebsforschung 1920–1970. Band 7, Stuttgart 2011.
- Karin Orth: Autonomie und Planung der Forschung. Förderpolitische Strategien der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1949–1968. Band 8, Stuttgart 2011.
- Heiko Stoff: Wirkstoffe. Eine Wissenschaftsgeschichte der Hormone, Vitamine und Enzyme, 1920–1970. Band 9, Stuttgart 2012.
- Alexander von Schwerin: Strahlenforschung. Bio- und Risikopolitik der DFG, 1920–1970. Band 10, Stuttgart 2015.
- Günther Luxbacher: Ersatzstoffe und Neue Werkstoffe. Metalle, Technik und Forschungspolitik in Deutschland im 20. Jahrhundert. Band 11, Stuttgart 2020
- Patrick Wagner: Notgemeinschaften der Wissenschaft. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in drei politischen Systemen, 1920 bis 1973. Band 12, Stuttgart 2021.
Beiträge zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft
- Isabel Heinemann, Patrick Wagner (Hg.): Wissenschaft - Planung – Vertreibung: Neuordnungskonzepte und Umsiedlungspolitik im 20. Jahrhundert, Band 1, Stuttgart 2006.
- Wolfgang U. Eckart (Hg.): Man, medicine and the state. The human body as an object of government sponsored medical research in the 20th century. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Band 2, Stuttgart 2006.
- Michael Zimmermann (Hg.): Zwischen Erziehung und Vernichtung. Zigeunerpolitik und Zigeunerforschung im Europa des 20. Jahrhunderts. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Band 3, Stuttgart 2007.
- Karin Orth, Willi Oberkrome (Hg.): Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1920-1970. Forschungsförderung im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Band 4, Stuttgart 2010.
- Helmuth Trischler, Mark Walker (Hg.): Physics and Politics. Research and Research Support in Twentieth Century Germany in International Perspective. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Band 5, Stuttgart 2007.
- Mark Walker, Karin Orth, Ulrich Herbert, Rüdiger vom Bruch (Hg.): The German Research Foundation 1920–1970. Funding Poised between Science and Politics. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Band 6, Stuttgart 2010.
- Karin Orth: Vertreibung aus dem Wissenschaftssystem. Gedenkbuch für die im Nationalsozialismus vertriebenen Gremienmitglieder der DFG. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Band 7, Stuttgart 2018.